Zum Abschluss der diesjährigen Interviewreihe zur Open Access Week kommt Prof. Dr. Beate Krickel vom Fachgebiet Philosophie der Kognition der TU Berlin zu Wort. Sie spricht über Open Access in ihrem Forschungsalltag und fordert kreative Lösungen, um Forschungsergebnisse weithin und interdisziplinär sichtbar zu machen.
UB: Open Access ist ein strategisches Ziel der TU Berlin. Wie sieht das in Ihrem Forschungsalltag aus? Ist Open Access ein Begriff? In welchen Kontexten nehmen Sie Diskussionen zu Open Access wahr?
BK: Der Umgang mit Open Access in meiner Disziplin scheint widersprüchlich: Alle wollen es, die wenigsten machen es. Diese Situation ist allerdings verständlich.
Einerseits scheinen die meisten davon überzeugt zu sein, dass Open Access eigentlich der Standard sein sollte. Unsere Forschung wird in der Regel aus öffentlichen Geldern finanziert; die entscheidenden Schritte im Publikationsprozess werden von Kolleg*innen ehrenamtlich übernommen (vor allem die Begutachtungen, die Auswahl der Gutachter*innen und die Redaktion). Zudem werden wissenschaftliche Publikationen nicht zum Privatvergnügen gelesen, sondern um die Forschung weiterzubringen, wovon nicht nur die eigene Disziplin etwas hat, sondern die Universitäten insgesamt und im Idealfall die Gesellschaft als Ganzes. Führt man sich das vor Augen, ist es eigentlich ein Witz, dass viele Publikationen immer noch hinter einer Paywall stecken.
Andererseits gibt es in meiner Disziplin nur wenige hochrangige reine Open-Access-Zeitschriften – und auch die besten gehören nicht zu den „Top Journals“ in meinem Feld. Da das Renommee der Zeitschriften, in denen man publiziert, bei Drittmittelanträgen, Stellenbesetzungen und generell für das Standing in der Fachcommunity de facto enorm wichtig ist, ist es karrierestrategisch in meiner Disziplin immer noch nicht ratsam den goldenen Weg des Open-Access-Publizierens zu gehen. Das muss sich unbedingt ändern – für den Übergang brauchen wir kreative Lösungen, wie wir Forschungspublikationen zugänglich machen können. Open-Access-Zweitveröffentlichungen bieten hier eine mögliche Lösung. In meiner Disziplin werden Publikationen vor allem auf kommerziellen Plattformen (Preprint) online geteilt. Der Vorteil dieser Plattformen ist, dass sie neben der Möglichkeit der Zweitveröffentlichung vor allem die Vernetzung zwischen Wissenschaftler*innen – auch international und interdisziplinär – ermöglichen und die eigenen Veröffentlichungen mehr Sichtbarkeit bekommen. Allerdings ist das langfristig keine gute Lösung, da wir die Veröffentlichung, Vermarktung und Vernetzung von Wissenschaft aus verschiedenen Gründen nicht außeruniversitären, kommerziellen Unternehmen überlassen sollten. Es gibt in meiner Disziplin einen nicht-kommerziellen Preprintserver (philpapers.org), der viel genutzt wird, international bekannt ist und viele Vorteile der kommerziellen Plattformen teilt, da auch hier der Vernetzungsgedanke im Vordergrund steht – aber eben nur innerhalb der Disziplin. Preprints gelten allerdings als nur begrenzt zitierfähig, da sie nicht die Seitenzählung der Verlage haben und somit diese bei Zitierungen nicht angegeben werden können. Das direkte und indirekte Zitieren ist für philosophische Veröffentlichungen allerdings zentral.
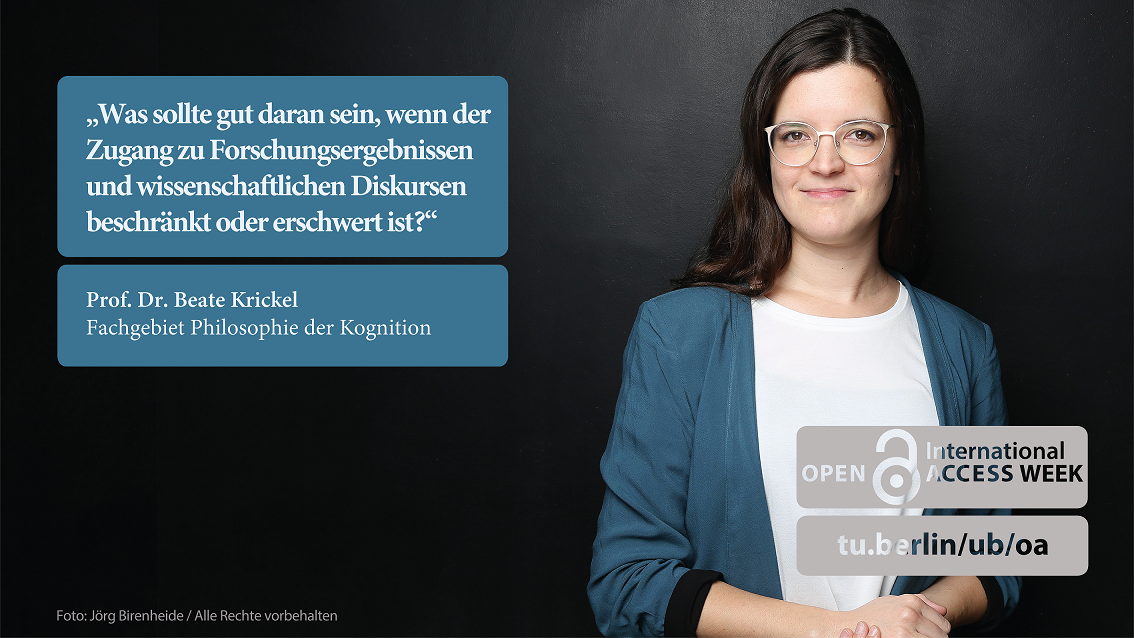
UB: Open Access hat den offenen Zugang zu wissenschaftlicher Information zum Ziel. Welche Rolle spielt Open Access in Ihrer (persönlichen) Publikationsstrategie?
BK: Seitdem ich eine unbefristete Stelle habe, versuche ich verstärkt in reinen Open-Access-Zeitschriften zu publizieren. Allerdings gibt es nur sehr wenige OA-Journals in meiner Disziplin, die einen guten Ruf haben. Und diese haben zudem niedrige Annahmequoten. Daher kann man Open-Access-Publizieren in meiner Disziplin noch nicht wirklich sinnvoll als Teil einer „Publikationsstrategie“ betrachten. Ich nutze seit Beginn dieses Jahres das Repositorium der TU Berlin und plane dies auch in Zukunft weiter zu nutzen. Das Open-Access-Team hat mich dabei wunderbar unterstützt.
UB: Gab es bereits konkrete Situationen in Ihrem Forschungsalltag, in denen Open Access hilfreich war?
BK: Das Teilen von Publikationen über kommerzielle Plattformen ist mittlerweile beinahe unerlässlich, um bei der Vielzahl von Veröffentlichungen und der starken Internationalisierung des Fachs auf dem neuesten Stand zu bleiben und um die eigene Forschung sichtbar zu machen. In der Biologie, Psychologie, Neurowissenschaft und anderen empirischen Wissenschaften ist oft gar nicht bekannt, dass Philosoph*innen zu Fragen arbeiten, die auch für diese Disziplinen relevant sind. Freie Verfügbarkeit war hier in meinem Forschungsalltag insofern hilfreich, dass ich über die Plattformen bereits einige Vortragseinladungen aus anderen Disziplinen bekommen habe, da beispielsweise Biologen auf meine Veröffentlichungen aufmerksam wurden. Diese Entwicklung ist – wie gesagt – allerdings auch problematisch, da das Onlinestellen auf diesen Plattformen häufig gar nicht zulässig ist. Zudem ist fragwürdig, ob man die Veröffentlichung und Vernetzung kommerziellen Unternehmen überlassen sollte. Nicht-kommerzielle Angebote können die Vorteile der kommerziellen Angebote bisher noch nicht einfangen und vor allem institutionelle Repositorien werden in meiner Disziplin nur wenig genutzt. Das muss sich ändern.
UB: Bis 2025 sollen laut der Digitalstrategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 70 Prozent aller neu erscheinenden wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland ausschließlich oder zusätzlich Open Access veröffentlicht werden. Erscheint Ihnen dieses Ziel sinnvoll? Was muss sich Ihrer Meinung nach verändern, damit dieses Vorhaben gelingen kann?
BK: : Prinzipiell finde ich dieses Ziel äußerst sinnvoll. Allerdings ist es fatal, wenn man gerade Wissenschaftler*innen in frühen Karrierestufen dazu verpflichtet – zumindest, solange es nur wenige reine Open-Access-Zeitschriften gibt, Kosten für Open Access hoch sind und vor allem, solange die reinen Open-Access-Zeitschriften nicht als „Top Journals“ in der Community betrachtet werden. Anders sieht es aus, wenn lediglich die zusätzliche Open-Access-Veröffentlichung verpflichtend wird. Hier könnten die institutionellen Repositorien auch in meiner Disziplin an Relevanz gewinnen. Allerdings frage ich mich, ob so auch wieder nur Preprints veröffentlicht werden könnten bzw. ob so rechtliche Spannungen entstehen, wenn die Erstveröffentlichung eben keine Open-Access-Veröffentlichung ist. In dem Fall wäre nicht viel gewonnen – vor allem wenn die Verantwortung für die rechtlichen Klärungen und die Risiken bei den Wissenschaftler*innen liegen würden. Solange die Verlage keine Zweitveröffentlichung der finalen Artikel erlauben bzw. längere Embargos für die Zweitveröffentlichung setzen, bleibt das Problem bestehen. Dazu kommt, dass die Anforderungen von Open Access und, in der Erweiterung Open Science, besonders für alle diejenigen ein erheblicher Mehraufwand ist, die empirische Daten erheben. Dies betrifft beispielsweise meine Kolleg*innen in der experimentellen Philosophie. Hier müssten Kompensationsmöglichkeiten geschaffen werden.
UB: Kurz und knapp in einem Satz: Was finden Sie gut an Open Access?
BK: Freie Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Publikationen sollte der Standard sein. Was sollte gut daran sein, wenn der Zugang zu Forschungsergebnissen und wissenschaftlichen Diskursen beschränkt oder erschwert ist?
UB: Geben Sie uns zum Abschluss einen Einblick in Ihr Forschungsfeld für Disziplinfremde. Mit welchen Fragen und Erkenntnissen beschäftigen Sie sich?
BK: In meiner Forschung beschäftige ich mich mit theoretischen Fragen, die sich aus der Überschneidung von Philosophie der Kognition, Wissenschaftstheorie und empirischer Kognitionsforschung ergeben. Es ist für meine Forschung essenziell, dass ich nicht nur Zugriff auf die einschlägigen philosophischen Fachzeitschriften habe, sondern auch auf Publikationen in der Psychologie, Kognitionswissenschaft und Neurowissenschaft. Wir brauchen eine stärkere interdisziplinäre Vernetzung, die oft (auch) durch die Beschränkung des Zugangs zu Forschungsartikeln erschwert wird.
Zur Person
Prof. Dr. Beate Krickel ist seit 2020 Professorin für Philosophie der Kognition an der TU Berlin. Teil ihres Forschungsalltags ist es, einen Überblick über den Stand der aktuellen theoretischen und empirischen Forschung zur Kognition zu behalten – Zugang zu Fachzeitschriften ist dafür essenziell.
Zu den weiteren Teilen der Interviewreihe (2022):
Dr.-Ing. Dragan Marinkovic: (Fachgebiet Strukturmechanik und Strukturberechnung) „Open Access sorgt für die Gleichheit an der Startlinie der Forschungsarbeit.“
Dr. Guilia Simonini (Fachgebiet Wissenschaftsgeschichte); „Hohe Kosten für Open Access müssen sinken und streng reglementiert werden.“